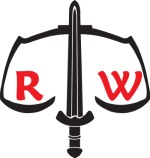Zum 8. Mai 1945
Prof. Dr. Hellmut Diwald, Würzburg
Verfasst vor 35 Jahren
Zum 8. Mai 1945
Gedenktage sind Tage der Besinnung, der Erinnerung, der Bilanz.
Der 40. (75) Jahrestag der militärischen Kapitulation Deutschlands beschäftigt die bundesrepublikanischen Medien seit Monaten. Die Unverfrorenheit des Versuchs, uns den 08.05.1945 als Datum der Befreiung schmackhaft zu machen, wird nur durch die Schamlosigkeit der Begründungen dafür übertroffen. Der 08.05.1945 scheint des Schicksals sicher zu sein, im Öffentlichen ein Tag der Heuchelei zu werden. Am 08.05.1945 wurde in Europa der Krieg beendet.
Wer diesen Tag mit Bewusstsein erlebt hat, wer sich an ihn erinnert ohne die Beschönigungen, Verzerrungen, Beflissenheiten und Lügen, mit denen seit Jahrzehnten unsere Geschichte und insbesondere unsere jüngere und jüngste Vergangenheit ungenießbar gemacht wird, der weiß es besser. Daran muss jeder von uns festhalten, ohne Konzessionen an das, was bequem ist, was gern gehört wird von denjenigen, die den politisch-offiziellen Beifall spenden.
Opportunisten sind die Totengräber der deutschen Selbstbehauptung.
Der 08.05.1945 war ein Tag des Elends, der Qual, der Trauer.
Deutschland, das deutsche Volk hatten sechs Jahre lang im gewaltigsten Krieg aller Zeiten um die Existenz gekämpft. Die Tapferkeit und Opferbereitschaft der Soldaten, die Charakterstärke und Unerschütterlichkeit der Frauen und Männer im Bombenhagel des alliierten Luftterrors, die Tränen der Mütter, der Waisen, wer die Erinnerung daran zuschanden macht, lähmt unseren Willen zur Selbstbehauptung. Daran sollten wir am 08.05.1945 denken.
Die Sieger von 1945 erklären, für die Rettung der Humanität einen Kreuzzug gegen Deutschland geführt und gewonnen zu haben.
Geführt auch mit den Mitteln eines Bombenkrieges, der das Kind, die Frauen, die Flüchtenden, die Greise genauso als Feind behandelte wie den regulären Soldaten.
Der Tag der militärischen Kapitulation der deutschen Armee brachte den Alliierten den Frieden.
Abermillionen von Deutschen brachte er die Hölle auf Erden. Haben die Sieger von 1945 keinen Anlass danach zu fragen, mit welchen Verbrechen sie dem Triumph ihres Kreuzzuges für die bedrohten Menschheitswerte das Siegel aufgedrückt haben?
In jenen Friedensjahren nach der Kapitulation, in denen von Ostpreußen bis nach Jugoslawien Deutsche erschlagen, hingemetzelt, vergewaltigt, gefoltert, vertrieben wurden – in jenen Jahren, die man uns jetzt zumutet, als Zeit der Befreiung und Wiege einer Zukunft zu feiern, die uns zum ersten Mal in unserer tausendjährigen Geschichte „Freiheit, Recht und Menschenwürde“ gebracht haben soll?
Denken wir daran am 08.05.1945.
Wer im 20. Jahrhundert einen Krieg verliert, wird vom Sieger zum Schuldigen und Verbrecher erklärt. Wie soll man das Wertesystem derjenigen einschätzen, die mit denselben Urteilskategorien dem deutschen Volk 1945 jede Moral und alle Rechte bestritten und wenige Jahre später, als deutsche Männer wieder als Soldaten gebraucht wurden, das deutsche Volk plötzlich als würdig erachteten, westliche und östliche Interessen mit der Waffe zu verteidigen?
Auch daran sollten wir am 08.05.1945 denken.
Der 08.05.1945 erinnert uns daran, dass wir besiegt wurden.
Ja, wenn es nur die militärische Niederlage gewesen wäre.
Es hätte nicht einmal das uralte Muster jener Kriege sein müssen, bei denen die Niederlagen kaum weniger ehrenvoll waren als die Siege. Aber Schuld eines ganzen Volkes für Verbrechen, die es als Volk nicht begangen hat, weil ein Volk keine Verbrechen begehen kann, sondern immer nur der Einzelne? Wenn von Schuld die Rede ist, dann auch von jener Schuld, dass wir nicht die Kraft und den Mut besaßen, uns gegen die generelle Herabsetzung zu wehren und uns nicht die Würde rauben zu lassen.
Standfestigkeit und Unbeirrbarkeit wären umso nötiger gewesen, als uns das Gift der moralischen Selbstzerstörung Jahr für Jahr eingeträufelt wurde.
Und wir wussten davon – denken wir daran.
Wir haben keinen Grund, den 08.05.1945 zu feiern.
Feiern sollen diejenigen, die sich für die Sieger halten.
Wie unsere früheren Gegner, die sich heute als unsere Freunde bezeichnen, ihre Feiern am 08.05.1945 mit dieser Freundschaft 1945 in Einklang bringen, ist allerdings nicht nur ihr eigenes Problem. Für uns ist es eine Gelegenheit, daran zu erinnern, dass die neue Zukunft, die uns von den Siegern 1945 beschert wurde, für unser Reich das Grab und für Deutschland und das deutsche Volk die Katastrophe seiner Zerstückelung bedeutete.
Die Siegesparaden der früheren Alliierten werden uns nur zeigen, dass wir noch immer die Besiegten von 1945 sind, dass unser Land besetztes Land ist und unsere regionale Souveränität eine von Gnaden der Sieger mit Vorbehalten gewährte Souveränität.
Daran müssen wir denken.
Die 40. Wiederkehr des 08.05.1945 ist das Fest der Sieger.
Es ist nicht unser Fest.
Uns dagegen steht die Erinnerung an Wahrheiten zu, deren Gehalt von keinem Datum abhängt.
Zur Lebensgeschichte des Einzelnen wie zur Geschichte eines Volkes gehören die Niederlagen genauso wie die Triumphe. Nur dann, wenn sich der Einzelne, wenn sich ein Volk selbst aufgibt und sklavisch unterwirft, geht alles verloren – in der Variante einer Feststellung des römischen Kaisers
Mark Aurel:
»Lass dir die Vergangenheit, lass dir die Zukunft nicht verfälschen. Du wirst, wenn es nötig ist, schon hinkommen, mit Hilfe derselben Geisteskraft, die dich das Gegenwärtige ertragen lässt.«
Prof. Dr. Hellmut Diwald, Würzburg
Zum 08.05.1945, in: Witikobrief, Folge 3, April/Mai 1985.
Hellmut Diwald (* 13. August 1924[1] in Schattau, Mähren; † 26. Mai 1993 in Würzburg) war ein deutscher Historiker und Publizist.

Leben und Laufbahn
Hellmut Diwald wuchs in Südmähren auf und besuchte zunächst in Prag die Schule, bevor die Familie 1938 nach Nürnberg übersiedelte.
Sein Vater war Ingenieur aus Österreich, seine Mutter Tschechin.
Er nahm aktiv am Zweiten Weltkrieg teil und legte 1944 ein Notabitur als Soldat in Frankreich ab.
Nach dem Krieg nahm er ein Maschinenbaustudium auf, das er 1947 am Polytechnikum in Nürnberg abschloss.
Anschließend studierte er in Hamburg und Erlangen
Philosophie, Germanistik und Geschichte. 1952 wurde er bei dem Religions- und Geistesgeschichtler Hans-Joachim Schoeps in Erlangen mit einer Arbeit zum Thema „Untersuchungen zum Geschichtsrealismus im 19. Jahrhundert“ promoviert. Er habilitierte sich 1958 mit einer Arbeit über den Philosophen Wilhelm Dilthey und lehrte von 1965 bis 1985 an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen Mittlere und Neuere Geschichte. Von 1948 bis 1966 war er außerdem Redakteur der Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte. Diwald lebte zuletzt in Würzburg, wo seine Frau Susanne Diwald bis 1989 Islamwissenschaften lehrte.
Publikationen und Medienarbeit
Diwald veröffentlichte 1969 eine Biographie über Wallenstein. 1970 gab er den Nachlass Ernst Ludwig von Gerlachs, eines konservativen Politikers der Bismarck-Zeit, heraus (siehe Gerlach-Archiv). Im selben Jahr kritisierte er die Deutschlandpolitik der Bundesregierung in „Die Anerkennung“. 1975 verfasste er den ersten Band der Propyläen-Geschichte Europas unter dem Titel Anspruch auf Mündigkeit. 1400–1555.
Diwald trat auch in Rundfunk und Fernsehen auf. Zu sehen war er in den 1970er Jahren mehrfach in der ZDF-Fernsehserie „Fragen zur Zeit“ oder von 1977 bis 1979 in der Sendereihe „Dokumente Deutschen Daseins“. In diesem Rahmen diskutierte er mit Sebastian Haffner. Daneben veröffentlichte Diwald Artikel in Zeitungen wie Die Welt oder Rheinischer Merkur.
Geschichte der Deutschen
Im Jahre 1978 erschien Diwalds Buch über die „Geschichte der Deutschen“. Im Unterschied zu herkömmlichen Darstellungen war es „gegenchronologisch“ aufgebaut. Das erste Kapitel begann mit einer Beschreibung der Gegenwart, die folgenden Kapitel führten schrittweise in die Vergangenheit zurück. Diwald behauptete, der Holocaust sei zwar „eins der grauenhaftesten Geschehnisse der Moderne“ gewesen, jedoch „durch bewusste Irreführungen, Täuschungen, Übertreibungen für den Zweck der totalen Disqualifizierung eines Volkes“ ausgebeutet worden.[3] Im KZ Auschwitz-Birkenau habe es so hohe Sterblichkeitsziffern gegeben, weil dort die nicht arbeitsfähigen Häftlinge konzentriert worden seien. Heinrich Himmler selbst habe sich um eine Senkung der Todesrate bemüht, unter der Endlösung der Judenfrage sei zunächst nicht die planmäßige Ermordung, sondern Auswanderung und Deportation der Juden in den Osten zu verstehen gewesen.[3]
Diwald wurden zahlreiche Irrtümer und Fehler nachgewiesen[4], Konzeption und Intention des Buchs wurden aber auch grundsätzlich kritisiert: Bewusst werde versucht, die Verbrechen der NS-Zeit zu verharmlosen. Diwald wies dies zurück[5], auf Drängen des Verlags wurden jedoch in der zweiten Auflage mehrere Textstellen geändert. Barbara Distel bezeichnete Diwalds Buch als einen Markstein in einem Prozess, in dem die Leugnung der nationalsozialistischen Massenmorde weiteste Verbreitung gefunden habe.[6] Thomas Assheuer und Hans Sarkowicz meinten, mit dem Erscheinen von Diwalds Buch habe der Erfolg einer neurechten „Re-Nationalisierung“ begonnen, die ein „«lawinenartiges Anwachsen» rechter Literatur ausgelöst habe – gegen den liberalistischen Geist der «Nationvergessenheit der CDU»“.[7] Für Claus Leggewie war Diwald ein „revisionistischer Historiker der ersten Stunde“.[8] Auch Golo Mann bezeichnete das Werk Diwalds, welches „Alt- und Neonazis mit Freude einschlürfen“ würden[9] als revisionistisch. Seitdem galt Diwald unter Geschichtswissenschaftlern in Deutschland als Außenseiter, „der entsprechend immer weniger Rücksichten nahm“.[10]
Eines seiner umfangreichsten Werke, Die Großen Ereignisse. Fünf Jahrtausende Weltgeschichte in Darstellungen und Dokumenten (erschienen 1990 in zunächst 6 Bänden mit ca. 3900 Seiten), ist der Öffentlichkeit weniger bekannt, da es sich um eine Exklusiv-Ausgabe des Verlages „Coron“ handelte, die nicht in die Buchhandlungen kam.
Politische Aktivitäten und Mitgliedschaften
Diwalds unbedingtes Eintreten für die deutsche Wiedervereinigung (z. B. in Wolfgang Venohr (Hrsg.): „Die deutsche Einheit kommt bestimmt“, Lübbe Verlag, Bergisch Gladbach, 1982) brachten ihm Beifall aus der politischen Rechten ein. Seine „reichsdeutschen Träumereien“ hätten, so die Schwäbische Zeitung am 4. Juni 1993, „einen bösen Beigeschmack“. Diwald war Mitglied zahlreicher Vereinigungen, die als rechtskonservativ bis rechtsextrem eingestuft worden oder werden. Laut Helmut Kellershohn und Alice Brauner-Orthen engagierte sich Diwald in der Deutschen Gildenschaft.[11][12] 1979 war er Gründungsmitglied der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste.
Im November 1981 gründete Diwald mit Alfred Schickel und Alfred Seidl die Zeitgeschichtliche Forschungsstelle Ingolstadt (ZFI), deren Vorstandsmitglied er wurde. Im Dezember 1983 gehörte er neben Armin Mohler, Wolfgang Seiffert, Franz Schönhuber, Robert Hepp, Bernard Willms und Hans-Joachim Arndt zu den Gründern der „konservativen Sammlungsbewegung“ Deutschlandrat in Bad Homburg.[13] Ohne selbst Mitglied gewesen zu sein, stand er den Republikanern nahe, für deren zweites Parteiprogramm er im Januar 1990 die Präambel verfasste. Später war er Kuratoriumsmitglied der „REP-nahen“ „Carl-Schurz-Stiftung“.[14] 1989 gründete er mit Wolfgang Venohr, Günther Deschner und anderen den Straube-Verlag in Erlangen.
Diwald gab Interviews für die Junge Freiheit, war Funktionär der sudetendeutschen „Gesinnungsgemeinschaft“ Witikobund, Gründungsmitglied der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste, Mitglied der Sudetendeutschen Landsmannschaft, der Deutschen Akademie für Bildung und Kultur, der Generalversammlung des Christlichen Jugenddorfwerks Deutschlands und des Goethe-Instituts München. Die Aktion Deutsches Königsberg führte ihn nach seinem Tod seit 1994 als Schirmherrn.
Nachwirkungen
1994 gab der Münchner Publizist Rolf-Josef Eibicht die Gedenkschrift Hellmut Diwald. Sein Vermächtnis für Deutschland, sein Mut zur Geschichte heraus. Zu den Verfassern zählten zahlreiche rechtskonservative und rechtsextreme Autoren, so auch Wigbert Grabert, in dessen Hohenrain-Verlag das Buch auch verlegt wurde. Ein Beitrag des Osnabrücker Soziologieprofessors Robert Hepp, in dem Zweifel am Holocaust geäußert wurden, erfüllte nach Ansicht der Staatsanwaltschaft Tübingen den Tatbestand der Volksverhetzung. Daraufhin wurden die Verlagsräume des Hohenrain-Verlags durchsucht, Restexemplare beschlagnahmt und gegen Autor und Verleger ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Dieses wurde später eingestellt, das Amtsgericht Tübingen ordnete mit Beschluss vom 3. Juni 1998 die Einziehung des Buches an.[15]
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Hellmut_Diwald